Trockenperiode und fehlender Niederschlag
Wenig Niederschlag
Im Rahmen der Wetterkunde gibt es viele Begriffe, die klar definiert sind. Sie haben manchmal Ober- oder Untergrenzen, fixe Temperaturzonen, sind regional eingegrenzt oder finden nur in bestimmten Wetterkonstellationen statt. Und dann gibt es Wetterbegriffe, für die gibt es keine klaren Richtlinien. Und zu diesen Begriffen gehört die Trockenperiode. Der Mensch weiß natürlich, dass es sich dabei um ein trockenes Wetter über einen längeren Zeitraum handelt. Es gibt keinen Regen, alles ist trocken.
Trockenperiode und Hintergründe
Es hängt von der Region und Jahreszeit ab, ob eine Trockenperiode vorliegt oder nicht und daher gibt es keine fixe Definition, ab wann sowie ab wie vielen regenlosen Tagen von einer Trockenperiode gesprochen werden kann. Ein Landwirt hat hier andere Empfindungen, als ein Autofahrer in der Stadt. Letzterer wird die Trockenperiode daran merken, dass das Fahrzeug immer mehr verstaubt, weil der Regen fehlt, um für Reinigung zu sorgen. Vor allem reinigt der Regen auch die Luft und das merken die Menschen selbst, wenn sie wieder freier atmen können und nicht das Gefühl haben, als würden sie Staub schlucken müssen.

Das ist ein Effekt, der in der Stadt besonders schnell auftritt. Und er verstärkt sich sogar noch, wenn es im Winter wärmer wird und durch das gestreute Material besonders viel Staub in die Luft kommt. Schotter wird durch die Fahrzeuge aufgewirbelt und so gelangt besonders viel Staub in die Luft. Ein Regenschauer kann helfen, die Luft zu reinigen.
Der Landwirt merkt den Mangel an Regen durch das Austrocknen der Felder. Im Extremfall gibt es einen Ernteausfall, weil es tage- oder wochenlang nicht mehr geregnet hatte. Es hängt von der Region ab, ob ein solcher Effekt öfter eintritt, denn das kann von den Rahmenbedingungen für das Wetter öfter oder seltener möglich sein. Das Wetter verändert sich aber ständig und so kann es auch in sonst feuchten Regionen einen akuten Mangel an Regen und/oder Schneefall geben.
Eine Trockenperiode ist meist im Frühjahr, im Sommer oder im Herbst möglich. Im Winter ist durch die kühle Temperatur die Wahrscheinlichkeit geringer, zumal die Verdunstung nicht so stark vorangetrieben wird. So führen einige niederschlagslose Tage im Winter nicht zu einer Trockenperiode, einige regenlose Tage im Hochsommer sehr wohl.
Extreme Trockenheit 2013 in Österreich
Ein Beispiel für eine Trockenperiode ist das so widersprüchliche Jahr 2013. Zu Jahresbeginn gab es viel Niederschlag, auf den im Frühjahr weiterer Regen folgte. Der negative Höhepunkt war intensiver Regen gegen Ende Mai 2013 und das nächste Jahrhunderthochwasser nach 2002, wobei die Pegelstände zum Teil sogar höher waren als 2002. Aber kaum war das Hochwasser abgezogen, begann die Sonne zu scheinen und legte bis Ende August kaum eine Pause ein. Es war staubtrocken mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht einmal 30 bis 35 %, während Werte um die 50 Prozent im Hochsommer üblich sind. Die Wiesen wurden gelb, der Boden staubte im wahrsten Sinne vor sich her - eine solche Trockenheit über Wochen ist für Österreich äußerst ungewöhnlich und war natürlich für die Landwirtschaft auch nicht förderlich.
Es war dies aber kein Einzelfall, denn in den Folgejahren häuften sich Trockenperioden, speziell im Frühjahr. Das Frühjahr ist in Mitteleuropa typischerweise ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauer. Es gibt Gewitteraktivitäten und es regnet genug, dass die Wiesen saftig grün sind und die Landwirtschaft auf gute Ernteerträge hoffen können. Aber in den letzten Jahren war es zum Teil so staubtrocken, dass viele Wiesen nur noch gelb waren und es massiv an Regen gefehlt hatte. Auch Laien konnten erkennen, dass die Feuchtigkeit fehlt.
Man konnte die Trockenheit auch an den Wetterdaten leicht ablesen. Dass es etwa im Großraum Wien an einem Apriltag eine Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 20 % (!!) hat, ist schon sehr außergewöhnlich, wird aber immer öfter angetroffen. Das ist natürlich für die Landwirtschaft und den privaten Garten kein so guter Ansatz für eine erfolgreiche Ernte.
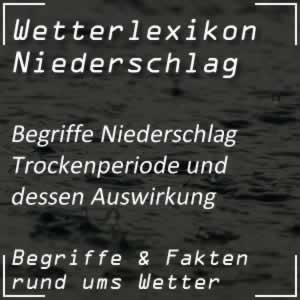 Artikel-Thema: Trockenperiode und fehlender Niederschlag
Artikel-Thema: Trockenperiode und fehlender Niederschlag